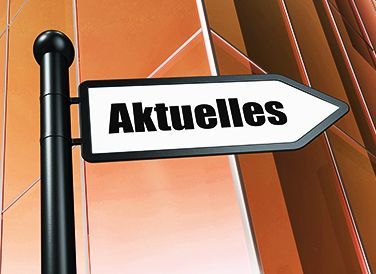Was wir voneinander lernen können – Lernszenarien
Lebenslang lernen - Fluch oder Segen?
Beitrag: Till Spurny
In dieser Kolumne nutze ich regelmäßig die Gelegenheit, in die Welt der Szenarien und Hypothesen einzutauchen. Die Grundidee ist dabei immer dieselbe: sich vorzustellen, wie etwas sein könnte, welche Auswüchse es haben könnte und welche Auswirkungen und Konsequenzen damit verbunden wären. Da sich daraus für mich immer wieder überraschende Erkenntnisse ergeben, möchte ich diesmal nach dem Lernen fragen.
Wie könnte sich das sogenannte lebenslange Lernen in künftigen Szenarien ausgestalten?
Bei dieser Frage ist der Blick in die eigene Vergangenheit aufschlussreich. Denn ein „lebenslanges“ Lernen impliziert, dass das, was man unter lernen versteht, unveränderlich feststeht, dass es über unsere berufliche Laufbahn hinweg weitergeht und uns möglicherweise auch in höherem Alter immer wieder vor dieselben Herausforderungen stellen wird. Tatsächlich jedoch ist gar nicht klar, dass wir überhaupt dasselbe meinen, wenn wir über lernen sprechen. Das Lernen in der Kindheit, Jugend, während Ausbildung und Studium war stets unterschiedlich und insbesondere im Berufsleben kann es ganz andere Bedeutungen annehmen.
Als rund um die Jahrtausendwende das Internet weitflächig eingeführt wurde, absolvierte ich einen Computerkurs, an dem unter anderem Menschen teilnahmen, die sich in fortgeschrittenem Alter umschulen ließen. Diese Art von Lernen, mit der diese Personen konfrontiert wurden, zähle ich mitunter zu den unvorteilhaftesten und unangenehmsten. Denn in diesem Fall standen Menschen mit jahrzehntelanger Berufserfahrung vor einer neuen Situation, in der ihre Erfahrungen, die eigentlich den wertvollsten Teil ihres Wissens ausmachen sollten, im Grunde nichts mehr wert waren. Damals konnte ich nicht ahnen, dass ich eines Tages selbst die Chance und auch Verantwortung haben würde, Entscheidungen über Fortbildungsformate zu treffen.
Mit dem Angebot der Fortbildungskampagne öffentliches Recht sollen für unsere Kunden praxis- und zukunftsrelevante Inhalte vermittelt werden. Dies erfolgt durch bewährte Seminarformate, die inhaltlich von den jeweiligen Experten und Expertinnen gestaltet werden. Die Art und Weise jedoch, in der das geschieht, unterliegt größeren Veränderungen als man vielleicht meinen möchte. Während der Lockdowns im Zuge der Coronapandemie hat sich die Arbeitswelt erheblich verändert und ganze Branchen wurden in ein neues Zeitalter verschoben, so auch die Fort- und Weiterbildung. Online-Seminare sind zwar wie die E-Mobile der Seminarwelt, doch genauso wie E-Autos immer noch Autos sind, so werden viele Glaubenssätze und Gewohnheiten aus der alten Seminarwelt in den neuen Online-Formaten wieder und wieder übernommen. Doch es kann auch anders gehen. Die vorhandene Technologie und die Bereitschaft, diese zu nutzen, eröffnen neue Möglichkeiten, Dinge wie Wissenserwerb, Erfahrungsaustausch und Praxiserfahrung auf andere Weise zu erwerben als in den traditionellen, bekannten Formaten.
Wissen, was man weiß und was man nicht weiß – das ist die höchste Kunst und die entscheidende Zutat!
Aus jahrelanger Erfahrung in der Konzeption von Seminarangeboten weiß ich, wie schwierig es ein kann, den Fortbildungsbedarf in einer Organisation tatsächlich maßzuschneidern und punktgenau zu definieren. Auch heute noch ist es deutlich einfacher, wenn Fortbildungen und Schulungen im Sinne von passiven „Berieselungs“-Veranstaltungen gehalten werden, anstatt tatsächlich auf der Ebene von individuellen und speziellen Bedürfnissen zu arbeiten. Möglicherweise kann die künstliche Intelligenz eines Tages an dieser Stelle Fortschritt und Verbesserung bringen. Doch eine Zukunft, in der eine künstliche Intelligenz ausrechnen wird, welches Wissen und welche Erfahrungen die Mitarbeitenden einer Organisation erlenen sollen, um künftige Herausforderungen zu bewältigen, ist sicherlich nicht erstrebenswert.
Wirklich erstrebenswert hingegen wäre ein Szenario, in dem jede und jeder einzelne den Funken der Begeisterung und des Staunens aufrecht halten kann und sich im wahrsten Sinne des Wortes wie ein forschender Geist durch unbekanntes Terrain bewegt, um neue Horizonte zu entdecken. Wie sieht das Lernen für wahre Entdecker aus? Die zahlreichen Beispiele aus der Geschichte lassen vermuten, dass die wohl erfüllendste und bereicherndste Art des Lernens diejenige sein muss, in der man angesichts der Fülle des Neuen, das man erfährt, gar nicht mehr hinterher kommt, alles zu notieren. Man muss es einfach festzuhalten, so faszinierend ist es.
Können Sie sich ein Szenario vorstellen, in dem Sie derart wissbegierig und begeistert lernen würden?
Das ist es, das ist das Szenario, in dem ich Sie im Seminar der Zukunft antreffen möchte! Beseelt und beflügelt vom Entdecken und der fortwährenden Suche nach immer neuen Erkenntnissen. So könnte ich mir das lebenslange Lernen durchaus vorstellen😊