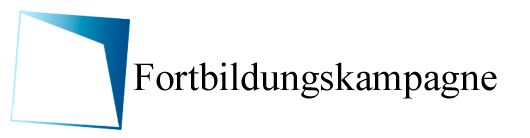Künstliche Intelligenz im öffentlichen Sektor – Status Quo, Potenziale und Herausforderungen
BERICHT
Kometenhafter Aufstieg der künstlichen Intelligenz
Künstliche Intelligenz hat sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt und ist bereits in vielen Bereichen des öffentlichen Sektors integriert. Fortschritte in der Rechenleistung, im maschinellen Lernen und in der Verarbeitung großer Datenmengen haben die Präzision und Leistungsfähigkeit von KI erheblich verbessert. Moderne KI-Modelle basieren auf Deep Learning, neuronalen Netzen und Natural Language Processing, wodurch menschenähnliche Entscheidungsfindung und Sprachverarbeitung ermöglicht werden. Technologische Durchbrüche wie GPT-4 oder OpenAI’s DALL·E zeigen eindrucksvoll die Fähigkeiten und das Potenzial dieser Entwicklungen.
Internationale Wettbewerbsfähigkeit und ethische Standards
Weltweit investieren Regierungen verstärkt in KI-Technologien, um Effizienzsteigerungen zu erzielen und neue Innovationsmöglichkeiten zu erschließen. Während die USA und China in der Entwicklung führend sind, haben auch die EU und Deutschland gezielte KI-Strategien entwickelt, um ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Dabei wird ein besonderer Fokus auf ethische Standards und transparente Algorithmen gelegt. Mit der Inkraftsetzung des AI Acts am 1. August 2024 wurden erste gesetzliche Rahmenbedingungen für den Umgang mit KI geschaffen, wodurch bestimmte Praktiken verboten wurden. Im August 2025 treten weitere Kapitel in Kraft, darunter Regelungen zu Behörden und Meldepflichten, Bestimmungen zu KI-Modellen, Governance-Strukturen und Sanktionen. Um die Konformität von KI-Modellen mit den Vorgaben des AI Acts zu überprüfen, wurden spezielle Werkzeuge wie der Large Language Model (LLM) Checker entwickelt, der Systeme hinsichtlich Cybersicherheit und diskriminierungsfreiem Output bewertet. Einige EU-Mitgliedsstaaten haben zudem begonnen, ergänzende nationale Gesetze zu erlassen. Die vollständige Anwendung des AI Acts ist für August 2027 vorgesehen.
KI in der öffentlichen Verwaltung: Breites Einsatzspektrum
Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung bietet enormes Potenzial, um Prozesse effizienter zu gestalten, Kosten zu senken und datenbasierte Entscheidungen zu erleichtern. In der Finanzverwaltung zum Beispiel automatisiert KI die Buchhaltung, optimiert Budgetprognosen und hilft, Betrugsversuche frühzeitig zu erkennen. Im Vergabemanagement verbessert sie Ausschreibungsverfahren, bewertet Anbieter und minimiert Risiken. Auch das Personalwesen profitiert: KI unterstützt bei der Bewerberauswahl, verwaltet digitale Personalakten und analysiert die Mitarbeiterzufriedenheit.
Darüber hinaus erleichtert KI die Bürgerkommunikation. Chatbots übernehmen Routineanfragen, optimieren Formularprozesse und ermöglichen mehrsprachige Kommunikation. Gleichzeitig trägt sie zur Analyse öffentlicher Stimmungsbilder bei und hilft, Krisensituationen frühzeitig zu erkennen. In der Infrastruktursteuerung optimiert KI die Verkehrsflüsse, den Energieverbrauch und die Umweltüberwachung. Schäden an Straßen oder Brücken lassen sich frühzeitig identifizieren, und Maßnahmen zur Luft- oder Wasserqualität können gezielt gesteuert werden. Auch in der öffentlichen Sicherheit ist KI zunehmend im Einsatz: Sie unterstützt Strafverfolgungsbehörden durch Datenanalysen, verbessert die Erkennung von Cyberangriffen und hilft bei der schnellen Einschätzung von Notrufen.
Herausforderungen und Voraussetzungen für eine erfolgreiche KI-Implementierung
Trotz der zahlreichen Vorteile erfordert der Einsatz von KI im öffentlichen Sektor auch sorgfältige Abwägungen und Investitionen. Datenschutz und Sicherheit spielen eine zentrale Rolle, insbesondere wenn es um die Verarbeitung sensibler Verwaltungsdaten geht. Strikte Datenschutzrichtlinien und robuste Sicherheitsmaßnahmen sind notwendig, um Datenmissbrauch oder Cyberangriffe zu verhindern. Ebenso müssen ethische Fragestellungen und gesellschaftliche Akzeptanz berücksichtigt werden. Damit Bürgerinnen und Bürger sowie Verwaltungsmitarbeitende Vertrauen in KI-Systeme entwickeln, sind transparente Algorithmen und verständliche Entscheidungsprozesse erforderlich.
Neben diesen Herausforderungen stellt auch die technische Umsetzung eine bedeutende Hürde dar. Die Implementierung von KI erfordert Investitionen in moderne IT-Infrastrukturen, Schulungsprogramme für Mitarbeitende und langfristige Wartungskonzepte. Denn in den kommenden Jahren wird der Einsatz von KI in der öffentlichen Verwaltung weiter zunehmen. Der Ausbau von Smart Cities, digitale Bürgerservices und KI-gestützte Entscheidungsmodelle werden weiter an Bedeutung gewinnen. Die Interaktion mit Bürgerinnen und Bürgern wird immer intuitiver werden, unterstützt durch Sprachassistenten, personalisierte Verwaltungsservices und vorausschauende Lösungen. Regulierungsmaßnahmen wie der AI Act setzen dabei einen klaren Rahmen, während technologische Fortschritte zu leistungsfähigeren und effizienteren KI-Systemen führen werden.
KI als Schlüsseltechnologie für die Verwaltung der Zukunft
Künstliche Intelligenz wird die öffentliche Verwaltung nachhaltig verändern. Sie bietet enorme Potenziale für Effizienzsteigerungen, Kosteneinsparungen und bessere Bürgerdienste. Gleichzeitig erfordert sie durchdachte Regulierungen, hohe ethische Standards und eine klare Strategie für die Integration in bestehende Verwaltungsstrukturen.
Die erfolgreiche Implementierung von KI im öffentlichen Sektor wird maßgeblich davon abhängen, ob es gelingt, innovative Technologien mit gesellschaftlicher Verantwortung in Einklang zu bringen. Wer frühzeitig in sichere, faire und transparente KI investiert, wird die Weichen für eine zukunftsfähige Verwaltung stellen.
Die Fortbildungskampagne öffentliches Recht bietet regelmäßig Praxisseminare zum Thema KI im öffentlichen Sektor an. Im ersten Halbjahr 2025 stehen folgende Veranstaltungen an: (Weitere Seminare sind in Planung.)
20.03.2025
J.6 Grundlagen der KI in der Öffentlichkeitsarbeit
Implementierung & Einsatzmöglichkeiten | KI-Tools | Anwendung von DEEPL und Chat GPT | Prompting | KI-Agenten | Übungen | Checklisten & Recherchelinks
KI-Verordnung (KI-VO) | Datenschutzanforderungen (DSGVO) | technische und rechtliche Aspekte | datenschutzkonformer Einsatz von KI | KI-Kompetenz gemäß Art. 4 KI-VO
Für weitere Informationen und Fragen wenden Sie sich bitte an:
Constanze Korb
Fortbildungskampagne öffentliches Recht
Presse und Kommunikation
Tel.: +49 (0) 30 89 56 27 13
E-Mail: presse@fortbildungskampagne.de
Über Fortbildungskampagne öffentliches Recht:
Die Fortbildungskampagne öffentliches Recht wurde 2019 in Berlin gegründet und erweitert das Weiterbildungsangebot im öffentlichen Sektor durch effiziente Veranstaltungen im Online-Format. ExpertInnen aus der Praxis, aus Forschung und Lehre und dem Rechtsbereich vermitteln ihr fundiertes Wissen im Rahmen von Seminaren und Inhouse-Schulungen. Die Veranstaltungen bieten einen direkten Austausch mit den ReferentInnen.
Die Fortbildungskampagne eruiert über fortlaufende Recherchen und den ständigen Austausch mit ExpertInnen und Institutionen den tatsächlichen Fortbildungsbedarf an aktuellen und praxisrelevanten Themen. Sie versteht sich als eine innovative Plattform für Wissenstransfer, deren Angebot die öffentliche Hand aktiv mitgestalten kann.